Blicke auf eine verschwindende Welt.
Schon als Kind infizierte sich der 1982 in Mexico City geborene und dort seine meisten Jugendjahre verbringende Andrés Cota Hiriart mit jenem Virus, der Weltreisende und energische Verfechter eines Naturschutzes hervorbringt, die Zeiten, Umgebungen und Mitmenschen als Gemeinsamkeiten des Planeten Erde betrachten. Tiere liebt er besonders, aber er hat gelernt, dass es wichtig ist, sie nicht zu vermenschlichen (oder unter artfremden Bedingungen zu halten), sondern als Elemente ihrer Ökosysteme zu betrachten.
Als solche erfüllen sie Aufgaben in einem Naturgespinst, das weitaus dichter miteinander verwoben ist als lange bekannt. Unterschätzt wurde auch, dass es sich Ausfälle nicht wirklich leisten kann. Das Verschwinden einer unauffällig wirkenden Art kann beträchtliche Negativfolgen an nur scheinbar weit entfernten Orten nach sich ziehen. Inzwischen geschieht dies an unzähligen Orten gleichzeitig. Womöglich ist der „point of no return“ längst überschritten, hat der Mensch die Ökosphäre so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass in den nächsten Jahrzehnten Tausende von Tier- und Pflanzenarten ungeachtet aller (ohnehin unzureichenden) Schutzmaßnahmen aussterben und weite Landstriche veröden werden.
Ein warnender und wehmütiger Unterton klingt immer mit, obwohl Hiriart die Erfahrungen eines von Tieren geprägten Lebens generell mit Humor darstellt. Natürlich will er damit unterhalten, aber vor allem möchte er die bittere Medizin schmackhafter machen: Aufgrund seiner weltweiten Reisen und den überall sichtbar werdenden Auswirkungen von Klimawandel, Abholzungen, Müllbergen und vielen weiteren Schlägen in den Nacken von Mutter Natur hegt Hiriart keine echten Hoffnungen bezüglich eines Wandels mehr.
Molch auf dem Rückzug
Hiriart ist noch relativ jung. Umso erschreckender lesen sich seine Erinnerungen an eine kaum zweieinhalb Jahrzehnte zurückliegende Zeit, als er und seine Freunde die titelgebenden Axolotl-Molche praktisch überall aus dem Wasser holen konnten. Binnen weniger Jahre haben Umweltzerstörung und -verschmutzung der mexikanischen Population beinahe den Garaus gemacht. Der Axolotl wird wohl nur in Gefangenschaft überleben. Ein Gegensteuern ist zeitaufwändig und teuer, wie Hiriart am Beispiel der Insel Guadelupe beschreibt (wo u. a. „Judasziegen“ mit Ortungssendern bestückt und freigelassen wurden, sich zu ihren verwilderten, gefräßigen Artgenossen gesellten und so von Jägern ins Visier genommen werden konnten.)
Solche traurigen Fakten lässt der Autor in seine Geschichte/n einfließen - wie gesagt maßvoll, um nicht jene zu verscheuchen, die zwar auch lesen, um sich zu informieren, aber nach Feierabend oder überhaupt nicht mit unschönen Wahrheiten belastet werden wollen. Als roter Faden dienen zunächst Hiriart seine Kindheit und Jugend, die durch bunte, oft aufregende und manchmal gefährliche Erlebnisse in der Tat beachtliche Darstellungsqualitäten aufweisen. Er orientiert sich an von ihm mehrfach zitierten Vorbildern wie Gerald Durrell, Douglas Adams und Mark Carwardine oder Redmond O’Hanlon. Sie waren in den Jahrzehnten vor 2000 dort durch unberührte Wildnis gestapft, die sich längst in Palmöl-Plantagen, Mülldeponien oder verwüstete, ausgelaugte Rodungsflächen verwandelt haben.
Dank seiner von Berufs wegen naturwissenschaftlich tätigen Eltern konnte der junge Hiriart seinem Drang nachgeben, vor allem Reptilien, Amphibien, Großinsekten und Spinnentiere zu halten - daheim und in großen Stückzahlen. Mancher Bewohner blieb länger als erwartet, was dem jungen Forscher die Erkenntnis bescherte, dass Pythons oder Krokodile sehr rasch wachsen und gern ihre Terrarien verlassen, um in einer Mietwohnung Angst und Schrecken zu verbreiten, während giftige Skorpione sich außerordentlich gut verstecken können, um überall & nirgends zu lauern; dass sie unter Schwarzlicht wunderschön leuchten, wird von den Betroffenen nicht als Ausgleich gewertet.
Der Inselspringer
Irgendwann hatte Hiriart begriffen, dass er den in seiner engen Wohnung gehaltenen Wesen keinen Gefallen tat, zumal der Aufwand sein Geld- und Zeitbudget allmählich sprengte (und seine Umgebung zunehmend ungnädiger reagierte). Er sorgte für eine artgerechte Unterbringung seiner Schützlinge und begann, die bewunderte Tiere und Pflanzen vor Ort zu besuchen, um sie in ihrer natürlichen Umwelt zu beobachten. Dabei spezialisierte er sich auf die Inseln dieser Welt. Sie stellen oft ganz eigene, nur hier existierende Ökosysteme dar, deren Beobachtung dem Evolutionsgedanken zum Durchbruch verhalf.
Folgerichtig reiste Hiriart zu den Galapagos-Inseln, wo einst Charles Darwin buchstäblich gesehen (und vor allem erkannt) hatte, wie sich Tier- und Pflanzenarten ständig verändern und anpassen. Andere Kapitel berichten über Inselfahrten nach Borneo, Sulawesi, Guadelupe und Komodo, wo Hiriart lernte, dass dort noch die Gesetze der Urzeit gelten und die mehr als drei Meter langen Warane menschliche Touristen sehr wohl als potenzielle Beute betrachten. Diese suchten die kleine, unglaublich abgelegene Insel trotzdem in so großer Zahl heim, dass die Regierung sie nun mehrheitlich abweisen muss: Auch der vordergründig alternative „Ökotourismus“ hat laut Hiriart seine Tücken, denn wohlmeinendes Interesse an entlegenen Orten und deren Bewohnern ändert nichts an deren Empfindlichkeit. Dann richten diejenigen Böses an, die eigentlich das Richtige im Sinn haben.
Wohin er auch reist, überall muss Hiriart feststellen, dass er nur noch die mühsam geschützten Reste alter Herrlichkeit vorfindet. Auf ständig schrumpfenden Flächen drängen sich die wenigen Überlebenden zusammen und nehmen an Zahl stetig ab. Stets siegen ökonomische über ökologische Ansprüche, wobei auch die Natur in den Reservaten und Schutzgebieten (s. o.) vor allem ‚genutzt‘ wird. Faktisch kann man jedes Tier, das größer ist als ein Pony (und nicht in einem Stall steht), auf die Liste der Todeskandidaten setzen. Doch die Sense des Schnitters saust weiter: Selbst Insektenformat bewahrt heute nicht mehr vor Verfolgung und Untergang. Ganze Funktionsgruppen werden aus den irdischen Ökosystemen getilgt, sodass Hiriart zu dem deprimierenden Schluss kommt, sich beeilen zu müssen, wenn er alle von ihm bewunderten Kreaturen noch in freier Wildbahn sehen möchte.
Fazit
Vom Tierliebhaber, der sich sein Heim mit ungewöhnlichen ‚Haustieren‘ teilte, entwickelte sich der Autor zum Biologen und Reisenden, der für das Überleben der Arten an ihren Herkunftsorten plädiert. Seine Berichte werden zu Bestandsaufnahmen einer Natur im Niedergang. Immerhin ist die bittere Pille humorvoll-süß verpackt, und der Verfasser hat ein Händchen dafür, Information unterhaltsam zu servieren.
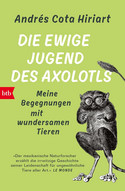

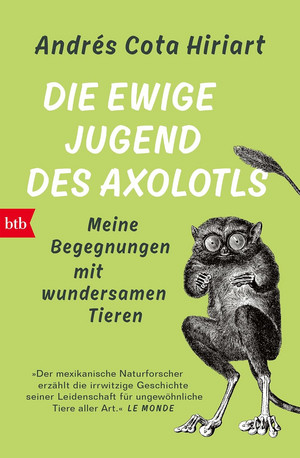

Deine Meinung zu »Die ewige Jugend des Axolotls«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!