Die Deutschen in der Welt
- Erschienen: Oktober 2024
- 0
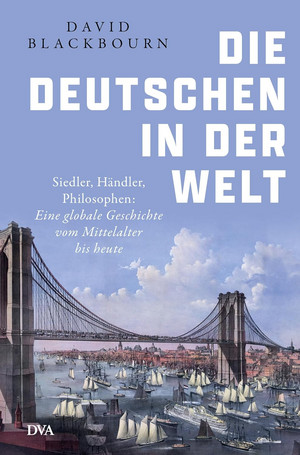
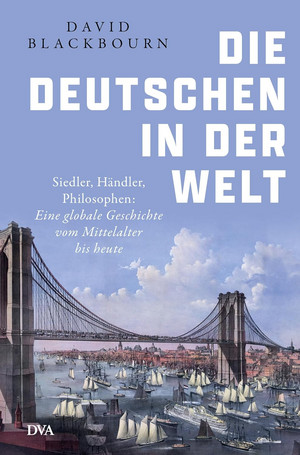
Deutsche Präsenz in wechselhafter Weltgeschichte.
Ein Buch wie ein Ziegelstein! Dass es trotz seiner 1000 Seiten zwar ein ähnliches Gewicht aufweist (fast 1,1 Kilogramm), aber trotzdem dem üblichen Format entspricht, liegt am qualitativ hochwertigen, spürbar dünnen Papier. Das Thema fordert indes Raum, denn in einem halben Jahrtausend waren deutsche Männer und Frauen weltweit an praktisch jeder historischen Entwicklung beteiligt; manchmal nur in kleiner Zahl, oft aber kopfstärker, als man annehmen würde.
Wie Autor David Blackbourn in seinem ausführlichen Vorwort darlegt, wusste er um die Problematik einer Darstellung, die absichtlich recht allgemein bzw. global gehalten ist und möglichst sämtliche Aspekte einer deutsch mitgeprägten Welthistorie berücksichtigen soll. Dabei ließ er die Jahre vor 1500 (bzw. 1492) unberücksichtigt und beschränkte sich auf die „moderne“ Geschichte, die etwa zeitgleich mit der (Wieder-) Entdeckung der beiden Amerikas und der (europäischen) Erfindung des Buchdrucks begann. Aus Historikersicht ist dieser Schnitt diskussionswürdig, da man durchaus schon vorher von einer „deutschen Geschichte“ sprechen kann, aber Blackbourn begründet seinen Startschuss, und als Autor bestimmt letztlich er über sein Konzept.
Deutlich länger als die Deutschen stehen die Briten auf dem Standpunkt, dass Informationen möglichst allgemeinverständlich vermittelt werden sollten, ohne darüber die Fakten zu vernachlässigen. Zwar gab und gibt es die ‚reine‘, mit ihrer speziellen Sprache arbeitende Fachliteratur, doch auch hochrangige Insel-Historiker waren sich selten zu schade, ihre Materien für ein breiteres, nicht-akademisches Publikum aufzubereiten, das sich für ihre Forschungsergebnisse interessiert - eine Haltung, die sich hierzulande aufgrund eines elitären Selbstverständnisses erst spät durchsetzte.
Faktenvermittlung mit Overkill-Gefahr
Nichtsdestotrotz droht diese Darstellung ihre Grenzen zu sprengen. Blackbourn hat seit 2014 an diesem Buch gearbeitet und dabei so viele Fakten gesammelt, dass er sie ungeachtet der Bemühungen, den Überblick zu wahren, seinen Lesern manchmal nicht vermittelt, sondern sie über ihnen ausgießt. Die Informationsflut wirkt dann bedrohlich, weil Blackbourn innerhalb kurzer Passagen wie ein allwissender Floh über ganze Kontinente springt.
Er hat eine beinahe bedrohlich große Portion Geschichte abgebissen und deshalb lesbar deutlich manchmal Mühe zu schlucken. „Die Deutschen in der Welt“ klingt als Titel trügerisch harmlos. Doch selbst die auf Deutschland bzw. Mitteleuropa zentrierten Kapitel schufen einen Faktenwust, vor dem man entweder kapitulieren oder auswählen muss. Blackbourn ist bemerkenswert furchtlos, wenn er praktisch sämtliche Aspekte des menschlichen Lebens berücksichtigt. Politik, Wirtschaft, Kultur und Kunst: Kein Aspekt deutscher Geschichtsträchtigkeit soll ihm entgehen!
In dieser Hinsicht quillt sein Werk wie gesagt über. Ungeachtet dessen mag man es nicht mehr aus der Hand legen, hat man mit der Lektüre begonnen. Blackbourn ist ein Rattenfänger im gänzlich positiven Sinn: Seinen Flötentönen folgt man bereitwillig über die ganze Welt! Dass dieses Buch so voluminös geworden ist, liegt auch an den „Geschichten aus der Geschichte“. Als Historiker fasst Blackbourn Ereignisse zu Entwicklungssträngen zusammen, analysiert und interpretiert sie, vergisst darüber hinaus jedoch nicht, dass die Faszination auch im Einzelschicksal liegt. Immer wieder pickt er prominente, aber auch in Vergessenheit geratene Deutsche heraus, die exemplarisch historisch Relevantes verkörpern, und scheut nicht vor der Anekdote zurück.
Das große Ganze und das Detail
Er schafft auf diese Weise Zugänge zu einem sperrigen Thema: Wie definiert man einen „deutschen“ Einfluss auf die Weltgeschichte? Wodurch wird dieser relevant - eine Frage, die Blackbourn nicht gänzlich zufriedenstellend beantworten kann: Die Bürger sämtlicher Staaten dieser Erde mischten und mischen im globalen Geschehen mit. Somit sind die Deutschen keine Besonderheit. Nichtsdestotrotz beeindruckt die Liste ihrer Präsenz.
Blackbourns Verdienst liegt darin, uns dies vor Augen zu führen und zu erläutern, wie es dazu kam. Allgemein bekannt sind deutschhistorisch geprägte Phänomene wie die Hanse, der Buchdruck, die Beteiligung deutscher Soldatensöldner an den US-amerikanischen Unabhängigkeitskriegen oder die vielen Millionen deutscher Auswanderer. Doch da ist viel mehr - jene deutsche Präsenz, die auf individuelle Initiative jenseits staatlicher Steuerung zurückgeht. Wenn ausländische Schiffe in See stachen, um eine unbekannte, potenziell gefährliche Welt, ihr merkantiles Potenzial, aber auch ihre Bewohner, Flora und Fauna kennenzulernen, waren erstaunlich oft Deutsche an Bord. Sie forschten, erkundeten, schrieben darüber und lockten weitere Landsleute in die Ferne.
Blackbourn legt dar, dass Forscher und Auswanderer einerseits ihre deutsche Heimat mit bzw. in sich trugen, aber andererseits bereit und fähig waren, sich in der Fremde anzupassen. Daraus entstanden deutsche ‚Inseln‘, die noch heute an exotischen Orten fassbar sind. Man wundert sich beispielsweise über ‚deutsche‘ Gründungen in Nord- und Südamerika und Ortsbilder, die man so aus der weit entfernten ‚Heimat‘ kennt. Traditionen haben sich erhalten, aber interessant verändert, denn zwischen den „Einheimischen“ und den „Zugewanderten“ herrschte und herrscht ungeachtet oft hässlicher Vorurteile ein reger, auch genetischer Austausch.
Der schwierige Blick aus der Ferne
Je weiter wir uns der Gegenwart nähern, desto mehr geht Blackbourn ins Detail. Schon lange vor dem Internet begann sich die Welt zu vernetzen. Einst auf den ersten Blick erkennbare Entwicklungsströme verästelten sich. Für scheinbar singuläre historische Phänomene gibt es allerdings auf den zweiten Blick unzählige Startpunkte. Gerade die jüngste Zeitgeschichte birgt deshalb Probleme: Die (deutsche) Kolonialgeschichte, der Erste Weltkrieg, der Aufstieg der Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg sind Themen, die auf eine breite Verständnisbasis gestellt werden müssen.
In diesem Punkt wird die globale Sicht beeinträchtigt: Deutschland kehrte die Verhältnisse um und kam über die Welt; dies oft gewalttätig, was sich in der Fach- und Sachliteratur widerspiegelt. Blackbourn gerät in tief ausgefahrene Spurrillen, wenn er nachzeichnet, was schon viele Historiker erforscht haben. Dies lässt sich wohl nicht vermeiden, aber es verschiebt wie gesagt den Blickwinkel.
Der Blick auf die Geschichte nach 1945 und besonders nach der Jahrtausendwende bleibt knapp. Das ist verständlich, denn Geschichte muss sich ‚setzen‘ und aus einem gewissen Abstand betrachtet werden. Nur so ist jene Objektivität möglich, die angestrebt wird, um Fakten so unbeeinflusst wie möglich zu gewichten. Was einst als der Weisheit letzter Schluss galt, kann sich nachträglich als Irrweg erweisen. Blackbourn verweist in dieser Hinsicht auf die deutsche Außenpolitik der Jahre nach 2000, die von einem heute naiv erscheinenden Glauben an eine politisch und wirtschaftlich zusammenwachsende Welt geprägt wurde.
Fazit
500 Jahre global-deutsche Geschichte werden auf 1000 Seiten im Überblick, aber auch im Detail dargestellt. Die Erkenntnistiefe ist nicht so groß, wie es der Autor sieht, aber die Fülle thematisch zielgerichteter Informationen beeindruckt. Oft bleibt es bei listenähnlichen Aufzeichnungen, doch die schiere Wucht wird durch die Schilderung exemplarischer Individualschicksale und historischer Anekdoten aufgelockert: ein Sachbuch mit Schmöker-Schwerkraft.
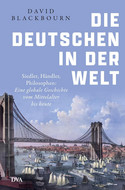


Deine Meinung zu »Die Deutschen in der Welt«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!