Jenseits von Jubel und Propaganda.
Aus historischen Filmaufnahmen und Fotos kennt man dieses Bild in unzähligen Variationen: Adolf Hitler spricht und badet dabei in einem Meer jubelnder Zuhörer. Deren Gesichter glänzen, und sie scheinen sich im Himmel zu wähnen, weil ihnen ihr „Führer“ sagt, was sie zu denken und zu tun haben. Das ist sie offensichtlich, die „Volksgemeinschaft“, die wie ein Mann (bzw. Frau) folgt und handelt, das System unterstützt und sich gegen jegliche Kritik stemmt.
Lässt sich von solchen Bildern tatsächlich auf die Wirklichkeit schließen? Fotos und Filme sind Momentaufnahmen, die niemals lückenlos eine Gesamtlage wiedergeben. Ungeachtet dessen wird von der Forschung seit den 1990er Jahren der Eindruck eines solide in sich ruhenden Deutschen Reiches erweckt, dessen Bürger - so nicht von den Restriktionen betroffen - mehrheitlich auf der Seite des Regimes standen: Daran erinnert der Historiker Peter Longerich in seiner Einleitung zu diesem Buch, um anschließend die Frage zu stellen, ob sich das in dieser Eindeutigkeit belegen lässt.
Die Antwort lautet erwartungsgemäß, aber in dieser Klarheit dennoch überraschend „Nein“. Nicht nur Fakten, sondern auch und gerade Gerüchte, Theorien und (kollektivgefällige) Ansichten können sich ‚verselbstständigen‘ und sich wie ein Schleier über die historische Wahrheit legen. Die Geschichte als Wissenschaft ist auf die Interpretation vorhandener Quellen angewiesen; eine doppelte Herausforderung, da die Überlieferung oft nur lückenhaft ist und Objektivität eine eher ideale als real existierende Tugend ist, sodass die Gefahr der Auswertung im Sinne einer bereits feststehenden Meinung besteht.
Auch Historiker sind nur Menschen, weshalb Fehlinformationen das Ergebnis auch ernsthafter Nachforschungen darstellen können. Deshalb gehört es zum üblichen Prozedere der (Geistes-) Wissenschaften, Wissen als fließendes Gut zu betrachten, das immer wieder neu gewichtet und bewertet werden muss. Im Rahmen dieses Prozesses ist es normal, dass auch verwurzelte Sachverhalte ins Wanken geraten bzw. durch neue Erkenntnisse ergänzt werden müssen.
Volkes Stimme, wie sie das Regime nicht hören wollte
Die Diskussion über die NS-Zeit ist über quasi sämtlichen Ebenen kompliziert und emotional aufgeladen, wobei die Fronten scheinbar fixiert sind: Nazis böse, Opposition gut, so könnte man die Grenzlinie salopp definieren, wobei für „die Deutschen“ die Rolle der „Täter“ vorgesehen ist. Das geht über diejenigen „Volksgenossen“ hinaus, die sich aktiv am Unrecht und an den Gräueltaten der Nazis beteiligten, und schließt auch die „Mitläufer“ ein, die schwiegen, weil sie Angst hatten, ihnen das Schicksal der verfolgten Mitbürger gleichgültig war oder sie profitieren konnten, weil jüdische Arbeitskollegen ihre Stellen und später ihren Besitz verloren.
Tritt man einen Schritt zurück, scheinen zumindest die Jahre bis zum Kriegsbeginn 1939 bzw. zur Katastrophe von Stalingrad 1943/44 eine Ära des Aufschwungs darzustellen, von dem die Mehrheit der Deutschen freudig profitierte. So vermittelt es wie schon erwähnt auch die Forschung, weshalb das Bild einer Gesellschaft von „Volksgenossen“, die vor dem Unrecht die Augen verschloss, so lange es ihnen gut erging, als Fakt galt.
Doch Geschichte ist nie ‚einfach‘, nicht schwarz oder weiß, sondern grau in unendlichen Schattierungen. Also konnte die Trias von Tätern, Mitläufern und Opfern so grenzklar nicht existieren. Peter Longerich, ein ausgewiesener Experte für die deutsche NS-Zeit, hat sich deshalb der Herausforderung gestellt, auch einen Blick hinter die Kulissen einer Geschichtsschreibung zu werfen, die in diesem Punkt einer neutralen Sichtung bedurfte.
Beschwichtigung als Alltagshandwerk
Er hat in zahlreichen Archiven gegraben und aussagekräftige Quellen gefunden, die von durchaus kollektiver Unzufriedenheit künden. Was die Sichtung und Auswertung zeitgenössischer Quellen ergibt, kann im Grunde nicht überraschen: Ein einiges „NS-Volk“ konnte es nie geben. Jeder Bürger ließ sich nicht wirklich ‚nazifizieren‘ - dies erst recht nicht, wenn seine persönlichen Forderungen und Erwartungen nicht befriedigt wurden. Da sich der vom NS-Regime und von der Propaganda herbeigejubelte Aufschwung nicht in den Geldbörsen großer Teile der Bevölkerung - vor allem Arbeiter, Handwerker, Bauern - niederschlug, waren diese kritisch und machten aus ihrer Unzufriedenheit keinen Hehl. Der nur in der Propaganda gefeierte Krieg sorgte für neue Ängste, die mit den einschneidenden Rationierungen, Engpässen (Lebensmittel, Kleidung etc.) und stetig gesteigerten Arbeitszeiten sowie angesichts der auch vom Regime nicht mehr zu verbergenden Niederlagen wuchsen.
Das NS-Regime glich dem mittelalterlichen Feudalsystem: Die Gefolgschaft des „Führers“ erwartete, für ihre Dienste mindestens mit „geldwerten Vorteilen“ - so würde es das Finanzamt nennen - bedacht zu werden. Auf diese Weise übernahmen treue, aber fachlich unfähige, oft kriminelle „Braunhemden“ Verwaltungsposten, für die sie keineswegs qualifiziert waren und die sie ausnutzen, um sich zu bereichern und alte Rechnungen zu begleichen. So litt der offiziell „gleichgeschaltete“ Staatsapparat unter Ineffizienz und Korruption, was den betroffenen „Volksgenossen“ nicht verborgen blieb.
Aus ihren Herzen machten sie deshalb wie gesagt keine Mördergrube. Die mehr oder weniger offenen Drohungen des Regimes - „Dafür landest du im KZ!“ - blieben dort ohne Wirkung, wo die Empörung sich einfach zu kopfstark artikulierte und höchstens überregional durch die gleichgeschaltete Presse zum Schweigen gebracht werden konnte. Hinzu kamen Reaktionen, die den NS-Vorschriften nicht offen widersprachen. Der „Volksgenosse“ wich den verordneten Massenveranstaltungen, aber auch den als Lockmittel erkannten Lustbarkeiten aus, zog sich ins Private zurück, bediente sich scheinbar ‚harmloser‘ Worte und Ausdrücke, die von den Schergen des Regimes nicht als Kritik oder Hohn verstanden oder geahndet werden konnten.
Der „Führer“ gegen Gott und seine irdischen Vertreter
Die Rolle der Kirche im NS-System unterliegt ebenfalls allzu allgemeinen Urteilen. Papst Pius XI. und vor allem Pius XII. gelten demnach als zum Teil willige Wegbereiter der Nazis, weil sie den katholischen Glauben sichern und religiöse ‚Konkurrenz‘ niederhalten wollten, während Clemens August Kardinal von Galen als „Löwe von Münster“ mutig die Stimme gegen die mörderischen Ausschreitungen der Nazis erhob. Das ist wiederum zum Teil richtig, muss aber vor dem Gesamthintergrund betrachtet werden.
Longerich zeichnet das Bild einer überzeugungsstarken und ungewöhnlich streitbaren Kirche, wobei beide Konfessionen sich nicht nur auf tief eingefahrene Traditionen und ihre Glaubensgemeinschaften verlassen konnten, sondern ungeachtet immer neuer Attacken seitens des Regimes einfallsreich Methoden ersannen, der von Hitler und seinen Paladinen vorgesehenen Entmachtung der Kirche Einhalt zu gebieten. Angesichts einer NS-seitig unterschätzten Glaubensfestigkeit der Deutschen konnten Katholiken und Evangelikale ihre eigenen Organisationen, die oft mit den NS-Spiegelbildern wie der Hitler-Jugend konkurrierten, lange schützen.
Seine wichtigsten Quellen hat Longerich in jenen „Stimmungsberichten“ gefunden, die von der NS-Staatspolizei bis 1936 reichsweit erstellt und an die oberen Parteiämter weitergeleitet wurden. Es passt zur Selbsttäuschung des Regimes, dass diese Berichte nach und nach eingestellt wurden, weil sie inhaltlich nicht das gewünschte Bild einig-entschlossener „Volksgenossen“ vermittelten, einen unerwartet ausgeprägten Gegenwind demonstrierten sowie tatsächliche Missstände unangenehm offenlegten. Die fehlenden Stapo-Berichte konnten für spätere Jahre meist durch andere, ähnliche Quellen aus den Bereichen Justiz, Lokalverwaltung oder Militär ersetzt werden.
Auf keinen Fall leidet die Faktendichte unter solchen Lücken, wie ein 120-seitiger Anmerkungsapparat eindrucksvoll zeigt. Dem Autor gelingt der Nachweis, dass die „Volksgemeinschaft“ eher ein Konstrukt der Propaganda darstellte, was das deutsche Volk allerdings keineswegs in einen Hort des kollektiven Widerstandes erhebt: „Anpassung an die gegebenen Verhältnisse, Risikovermeidung, Opportunismus und nicht zuletzt der Mangel an Alternativen spielten im Verhältnis der Menschen zum Regime eine größere Rolle als Konsens und Zustimmung.“ (S. 473) Hinzu kam die Allgegenwärtigkeit eines nationalsozialistischen Systems, „... das in allen Lebensbereichen und auf allen Ebenen in die Gesellschaft einwirkte.“ (S. 473)
Fazit
Eine umfangreiche Quellenauswertung korrigiert die allzu tief eingefahrene Ansicht, dass die „Volksgemeinschaft“ kollektiv hinter dem NS-Regime stand. Zahlreiche Belege sorgen in ihrer Deutlichkeit für Überraschungen, wobei der gut strukturierte und angenehm lesbare Text die komplexe Materie erfassbar macht.


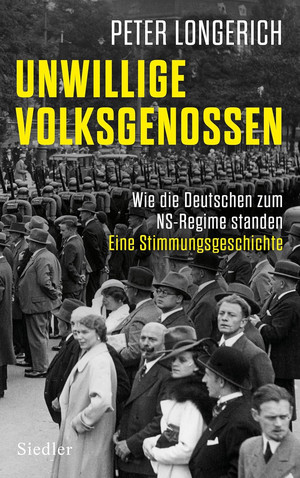

Deine Meinung zu »Unwillige Volksgenossen«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!