Im Namen des Volkes…
…ergeht das folgende Urteil. Mit dieser Formulierung beginnen die Strafrichter in Deutschland ihre Urteilsverkündung. Natürlich ergehen die Urteile nicht wirklich im Namen des Volkes. Es gibt ja nicht vor jeder Urteilsverkündung eine Volksbefragung oder ähnliches. „Im Namen des Volkes“ nur deshalb, weil in Deutschland gemäß Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und es außerdem in § 268 Absatz 1 der Strafprozessordnung so steht. In Wirklichkeit muss das Volk darauf vertrauen, dass Strafgerichte so entscheiden, wie es das Gesetz vorgibt. Und am besten stimmt das Urteil auch noch mit den moralischen Wertevorstellungen der Menschen überein und ist im allerbesten Falle auch noch gerecht. Dann ist „das Volk“ zufrieden.
Der Prozess
In diesem Fall hatte das Hamburger Landgericht unter der Vorsitzenden Richterin Anne Meier – Göring über die Taten des Bruno Dey zu entscheiden. Er war ehemaliger SS – Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Angeklagt war er wegen Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen – Tatzeit war das Jahr 1944. Die Vorsitzende Richterin und ihre Beisitzer mussten sich also Gedanken über die Schuld des damals 17 – Jährigen Bruno Dey machen. Welche Gedanken machte sich der Angeklagte, als er als Wachmann in Stutthof arbeitete? Hatte er den Vorsatz zum Mord? Hätte er den Befehl, Wache zu stehen, problemlos verweigern können? Warum wurde er erst jetzt angeklagt? Was hatten die zahlreichen Holocaustüberlebenden, welche im Prozess als Zeugen aussagten, aus dem Lager Stutthof zu berichten? All diesen Fragen musste die Richterin nachgehen, sorgfältig prüfen und abwägen, um letztendlich ein Urteil „im Namen des Volkes“ zu sprechen.
Nah am Geschehen
So viel zum Hintergrund dieses Buches. Der Autor Tobias Buck ist gelernter Jurist und arbeitet als Journalist und Managing Editor bei der Financial Times. Er war an jedem Prozesstag anwesend und erzählt aus den zahlreichen Zeugenbefragungen von Holocaustüberlebenden, den Vernehmungen des Angeklagten und den Aussagen des Staatsanwaltes und dem Verteidiger des Angeklagten. Dabei weiß er stets sowohl die politischen als auch die juristischen Details des Prozesses einzuordnen und für Laien zu erklären. Seine Erzählweise ist lebendig und auf den Punkt gebracht, als wäre man selbst Zuschauer im Gerichtsprozess.
„[…] einer der strittigsten Fragen, die den Prozess beherrschten: Was wusste der Angeklagte vom Massenmord an den Juden und den anderen Stutthof – Häftlingen, und was hätte er wissen müssen? Was wusste er über die Gaskammer und das Krematorium, die Erschießungen und das Massensterben aufgrund der Verweigerung einer ausreichenden Ernährung, Pflege und medizinischen Versorgung kranker Häftlinge?“
Der Mittelpunkt des Buches bildet der Prozess Bruno Dey. Buck schreibt nebenbei auch über das Problem, dass die NS – Justiz nach dem zweiten Weltkrieg weitestgehend weitergearbeitet hat, Stichwort Persilscheine. Zwischendurch berichtet der Autor über seine eigene Familiengeschichte mit NS – Vergangenheit, sowie über die deutsche Erinnerungskultur an die Geschehnisse im dritten Reich.
Dabei verliert Buck nie den Blick für den Prozess um Bruno Dey. Besonders beeindruckend und emotional sind die Aussagen der Überlebenden von Stutthof und die Frage, ob es für den Angeklagten möglich war, sich aus dem Konzentrationslager zu entfernen und wenn ja, mit welchen Folgen.
„Der Weg in die Freiheit führt nur durch den Schornstein.“
Die überlebenden Stutthof – Zeugen sagen aus, wie sie misshandelt wurden, unterernährt waren und jeden Tag um ihr Leben bangen mussten. Einige sind weit angereist. Es geht den meisten Überlebenden bei ihrer Aussage im Prozess nicht in erster Linie um Vergebung oder Vergeltung, sondern darum, dass ihre Geschichte gehört wird. Mögen die Geschehnisse in Stutthof lange zurückliegen, gezeichnet von ihren schrecklichen Erlebnissen sind die Überlebenden heute noch, auch wenn sie diese der Richterin in sachlicher und ruhiger Art und Weise vortragen. Es geht auch um den Kampf gegen das Vergessen. Eine Überlebende wurde am Ende ihrer Aussage gefragt, ob sie dem Gericht noch etwas sagen möchte:
„Im Lager haben wir gesagt, falls wir überleben, müssen wir das bis zu unserem Tod bezeugen. […] Und das tue ich jetzt. Es ist eine Verpflichtung.“
Die Herausforderung bei Prozessen gegen Nazi – Verbrecher ist, dass das deutsche Strafrecht ein sogenanntes Individualstrafrecht ist. Es muss einer Person eine konkrete Tötungshandlung nachgewiesen werden. Die Geschehen liegen lange zurück, und lassen sich nur schwer rekonstruieren und gerade Wachleute begingen meistens selbst keine Tötungshandlungen. Es bleibt dann lediglich bei einer Beihilfe zum Mord. So war es beim Wachmann John Demjanjuk, dessen Urteil für die Verurteilung von Nazi - Wachleuten wegweisend war. Auch diesem Fall widmet Buck ein Kapitel, bei dem es um die Frage geht, warum Wachleute meist lediglich als Gehilfen und nicht als Täter bestraft wurden.
Fazit
Zur rechtlichen Aufarbeitung von Nazi – Verbrechen gibt es fast nur Fachliteratur. Tobias Buck liefert eine gut recherchierte und emotionale Lektüre, die man auch als juristischer Laie sehr gut lesen kann. Das letzte Urteil ist kein typisches Sachbuch, das man auszugsweise liest, sondern es ist wie ein Krimi, an den man von vorne bis hinten festgebunden ist. Wer sich für die Aufarbeitung von NS – Verbrechen interessiert, kommt an diesem Buch nicht vorbei.


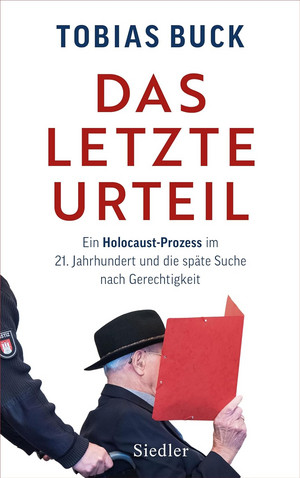

Deine Meinung zu »Das letzte Urteil«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!